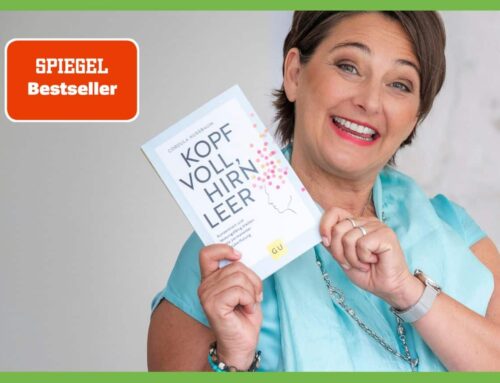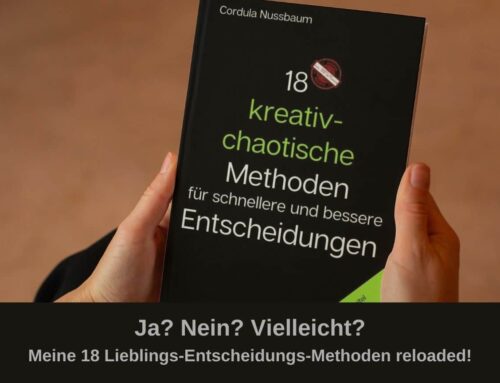Jochen Mai ist Wirtschaftsjournalist und leitet das Ressort „Management + Erfolg“ bei der Wirtschaftswoche. Sein erstes Buch „Die Karrierebibel“ war ein voller Erfolg und wurde von der Stiftung Warentest als „empfehlenswert“ bewertet . Nun ist sein neues Buch „Die Büro-Alltags-Bibel“ erschienen und Jochen Mai verrät uns, was uns darin erwartet.
Die Büro-Alltags-Bibel ist der Nachfolger von der Karriere-Bibel. Was hat Dich dazu bewogen, genau den Büro-Alltag zum Thema zu wählen?
Jochen Mai: In diesem Fall war es mein Blog, bzw. die Leser. Seit karrierebibel.de zu meinem ersten Buch existiert, habe ich immer wieder über Büro-Themen geschrieben – und hierzu gab es nicht nur erstaunlich viel Material wie Studien oder Statistiken, sondern auch jede Menge Leser-Reaktionen, davon viele auch per Mail, weil sich die Betroffenen nicht in der Öffentlichkeit über Chef und Kollegen auslassen wollten. Und es ist ja auch so: Rund 17 Millionen Bundesbürger verbringen 212 Tage im Jahr in einem Büro. Dort analysieren und archivieren wir dann; wir debattieren, fabrizieren, optimieren und organisieren, wir produzieren, programmieren, präsentieren, provozieren, reflektieren, resignieren, sanieren, sabotieren, simulieren, spekulieren, taktieren, telefonieren und theoretisieren – bis zu zehn Stunden täglich. Damit ist unser Arbeitsplatz nicht nur ein enorm einnehmender Lebensraum – ganz oft ist er auch ein veritables Krisengebiet, das unser Verhalten, unsere Psyche und sogar die Gesundheit entscheidend beeinflussen kann. Ich finde, das ist ein ganzes Buch wert.
Wie unterscheidet sich die Büro-Alltags-Bibel von der Karriere-Bibel?
Naja, ganz platt: Das Cover ist Orange statt Rot; es steht ein anderer Titel drauf und andere Texte stecken drin. Ich nehme aber mal an, du spielst auf die Buchstruktur an… Die Karriere-Bibel war ja wie ein Tagebuch aufgebaut – also statt Seitenzahlen gab es Datumsangaben und für jeden Tag des Jahres eine Kolumne, also 366 insgesamt (365 + 1 weil 2008 ein Schaltjahr war). Wobei die einzelnen Texte so aufgebaut waren, dass jeder Monat unter einem Kernthema stand und man so im Verlauf eines Jahres einen typischen Karrierezyklus durchlaufen konnte – angefangen im Januar mit Bewerbungstipps und endend im Dezember mit Kündigungsthemen und der Frage, wie man ein optimales Comeback zelebriert. Bei der Büro-Alltags-Bibel bin ich wieder bewusst einen anderen, kreativen Weg bei der Buchstruktur gegangen: Sie bildet den Verlauf eines typischen Bürotages ab – beginnend um 7.00 Uhr mit Tipps für den optimalen Start in den Tag bis hin zum späten (Feier-)Abend und Empfehlungen für besseren Schlaf. Sicher, manche Uhrzeiten sind mehr oder weniger willkürlich gewählt und entsprechen eher den Durchschnittswerten, die ich bei meinen Recherchen ermittelt habe. Und mir ist natürlich klar, dass die Abfolge der einzelnen Alltagserlebnisse individuell variieren und sich sogar wiederholen kann. Deshalb habe ich die Kapitel so geschrieben, dass die Leser sie auch bequem in Ihrer ganz persönlichen Reihenfolge lesen oder gezielt nachschlagen können, etwa um vorhandenes Wissen zu vertiefen.
Kreativität ist viel gepriesen und meistens auch entscheidend für die Karriere. Aber was genau zeichnet kreative Menschen aus?
Ich habe mir gedacht, dass du diese Frage stellen würdest. Dazu gibt es einen wirklich bemerkenswerten Aufsatz von Mihály Csikszentmihályi, der darin feststellt, dass es tatsächlich einige auffällige Gemeinsamkeiten von Kreativen gibt. Kreative seien etwa nicht nur enorm vielseitig, sie seien auch sehr widersprüchliche Menschen, die gegensätzliche Eigenschaften auf famose Weise vereinen. So sind Kreative zum Beispiel häufig smart und naiv zugleich.
„Kreative sind immer auch enorm leidenschaftlich.“ (Jochen Mai)
Ich dachte immer, das eine schließt das andere aus?
Eine nahezu paradoxe Konstellation, ich weiß. Bei Licht betrachtet erklärt sie sich jedoch: Naivität kann auch eine Form von Neugier sein, so wie sie bei Kindern vorkommt. Weil sie noch nicht so abgeklärt sind, nehmen diese Menschen ihre Umwelt aufmerksamer wahr, hinterfragen mehr und kommen so zu neuen Erkenntnissen. Kreative nutzen diese Naivität, um unvoreingenommen an die Dinge heranzugehen. Eine der ältesten Studien zum Thema Intelligenz wiederum stammt von Lewis Terman von der Stanford Universität aus dem Jahr 1921. Der konnte zeigen, dass Kinder mit einem hohen Intelligenzquotienten im späteren Leben zwar kaum Probleme hatten. Übermäßig hohe Intelligenz allerdings korrelierte nicht zwangsläufig mit größerem Lebenserfolg. Jüngere Studien bestätigen, dass dieser Scheitelpunkt bei einem IQ-Wert um 120 liegt. Csikszentmihályi vermutet, dass es unter diesem Wert schwer ist, ausgesprochen kreativ zu sein, weil den Menschen dann die Fähigkeit fehlt, gegenteilig oder widersprüchlich (Fachjargon: divergent statt konvergent) zu denken. Intelligenz ist also eine Voraussetzung, ein übermäßig hoher Intelligenzquotient muss aber nicht automatisch kreativer machen. Eine weitere Eigenschaft kreativer Zeitgenossen ist, ebenso verspielt wie diszipliniert zu sein. Imagination und Vorstellungskraft sind Bedingungen, um innovativ zu wirken. Während die meisten Menschen zuerst fragen „Warum?“, fragen sich Kreative lieber: „Warum eigentlich nicht?“ Gleichzeitig können sie sich in ihre Sache verbeißen und entsprechend konzentriert bis spät in die Nacht daran arbeiten, wenn etwas fertig werden muss. Deshalb sind Kreative immer auch enorm leidenschaftlich. Ohne diese Leidenschaft würden sie irgendwann die Lust an der Sache verlieren und aufgeben – erst recht, wenn sich der Erfolg nicht gleich einstellt.
Hast Du Tipps, wie man der eigenen Kreativität auf die Sprünge helfen kann?
Ja, durchaus. Ich glaube, du hast darüber auch schon ein paar Mal geschrieben. Da gibt es etwa die klassischen Methoden, die wirklich funktionieren. Also etwa die sogenannte Disney-Methode oder die sechs DeBono-Hüte. Im Grunde funktionieren diese Methoden immer gleich: Sie schärfen die Selbstwahrnehmung. Man setzt dabei unterschiedliche Brillen auf, um sich einem Problem zu nähern – mal als kreativer Träumer, mal als rationaler Kritiker, als Moderator, der alle Gedanken verbindet. Es gibt aber noch eine weitere Technik, die man unter dem Fachbegriff „mentale Stimulanz“ zusammenfassen kann.
Was versteht man darunter?
Unser Gehirn giert nach Neuem, nach Ungewohntem, nach sensorischen Reizen. Unser Geist will lernen. Dafür ist er gemacht. Und wann immer wir unsere grauen Zellen mit Neuem füttern, regen wir diese enorm an. Und steigern so unsere kognitiven wie kreativen Fähigkeiten.
Ein Beispiel: Mach doch morgen früh alles mal mit links – vorausgesetzt, du bist Rechtshänder! Putzen dir morgens mit der linken Hand die Zähne, kämm dir so die Haare, creme dich mit links ein – alles so wie jeden Morgen, nur diesmal nicht mit deiner dominanten Hand, sondern mit der anderen. Das kann nicht nur enorm amüsant werden, sondern regt die Oberstube gewaltig an. Oder: Gehe morgen bewusst einen ganz anderen (Um)Weg zur Arbeit, benutze die andere Straßenseite als sonst, usw. Oder als Tipp fürs Büro: Richte auf dem Flur eine Pinnwand ein, auf der jeder Probleme vermerken kann, für die er eine Lösung sucht und fordere anschließend alle Kollegen auf, ihre Ideen und Lösungen dazuzuschreiben – zum Beispiel mit Haftzetteln. Diese optische Lösung wirkt unglaublich inspirierend – und zwar schon auf jene, die die Wand nur betrachten.
Bist Du selbst in den Tiefen Deines Herzens ein bisschen kreativ-chaotisch?
Ich fürchte, da muss ich dich enttäuschen. Es gibt zwar auch bei mir mal chaotische Phasen, aber die sind kurz. Sehr kurz. Ich bin ein überaus durchorganisierter Mensch. Mein Schreibtisch ist manchen Kollegen schon suspekt, weil man darauf im Notfall am offenen Herzen operieren könnte, und ich liebe es, Strategien auszuknobeln, wie man mit möglichst wenig Aufwand, ein Maximum-Ergebnis erzielt.
Verrate uns doch bitte eine solche Mini-Max-Strategie!
Nee, Betriebsgeheimnis. Ich mach das intuitiv. Bin sehr schnell und sehr durchorganisiert.
„Die meisten Chefs lieben aufgeräumte Büros.“ (Jochen Mai)
Ein aufgeräumter Schreibtisch ist für kreative Chaoten meist ein Ding der Unmöglichkeit. Wie weit kann man es im Büro treiben mit der Unordnung am Schreibtisch?
Das hängt auch ein bisschen vom Boss und der Größe des Schreibtischs ab. Wenn man Sorge haben muss, dass einen Wanderdünen aus Aktendeckeln verschütten oder sich darunter bereits Biotope gebildet haben, ist die Grenze definitiv überschritten. Fest steht aber: Die meisten Chefs lieben aufgeräumte Büros. Laut Studien des britischen Psychologen Cary Cooper schätzen 70 Prozent aller Manager Mitarbeiter mit ordentlichen Schreibtischen.
Woran könnte das liegen?
Sie assoziieren damit einen ebenso strukturierten wie aufgeräumten Geist. Du sagst es aber selbst. Das mit dem Aufräumen ist so eine Sache. Wer etwa zum Messi neigt, wird mit einer Hauruck-Putzaktion kaum etwas bewirken. Er schafft damit allenfalls Platz für neuen Tumult. Die einzige Chance, Ordnung dauerhaft zu etablieren, ist, sie sich zur Gewohnheit zu machen und alles was man anpackt, danach sofort wieder wegzuräumen. Entsprechend raten erfahrene Ordnungshüter dazu, allen Arbeitsutensilien feste Plätze zuzuweisen: alle Stifte in einen Stifthalter; Tacker, Locher, Tesafilm, Büroklammern & Co. in eine bestimmte Schublade; Briefe und Zettel in spezielle Ablagen und so weiter. Manche Profis sortieren die Arbeitsgeräte gar zu so genannten Themeninseln – also Stifte, Radierer und Spitzer zusammen oder Brieföffner zu Tacker und Locher. Das spart später Suchzeit.
Ein weiterer Weg zu einem aufgeräumteren Büro ist, seine Utensilien zu hierarchisieren. Manche Dinge braucht man öfter als andere, Kalender und Stifte zum Beispiel. Die gehören in die unmittelbare Nähe des Arbeitsplatzes, am besten in Griffweite. Andere Dinge können dafür im Umfeld platziert werden. So werden auch die Arbeitsabläufe schneller. Aber nur, wenn man auch den dritten Tipp beherzigt: reduzieren. Stifte, die nicht mehr schreiben, gehören in den Mülleimer. Ansonsten reichen in der Regel ein Bleistift, ein Kuli, ein Fineliner und vielleicht noch ein paar Textmarker. Den Rest kann und sollte man zurück ins Sekretariat bringen – oder wegschmeißen. Die Kunst, Ordnung zu halten, besteht im Wesentlichen darin, sich von Überflüssigem zu trennen – und zwar bevor man den Rest organisiert.
Man stößt immer mal wieder auf Chefs, die eindeutig nicht zu einem passen. Was kann man tun, damit die Zusammenarbeit so reibungslos wie möglich abläuft?
Ich glaube, das liegt ganz häufig schlicht an falschen oder überzogenen Erwartungen. Der Chef soll uns fordern und fördern, unsere Leistungen ständig beklatschen und belohnen, uns viel bezahlen und obendrein bei der Selbstverwirklichung beispringen sowie im Büro für Spiel, Spaß und Spannung sorgen. Aber im Ernst: Wer außer einer herabgestiegenen Gottheit ist dazu in der Lage? Umgekehrt: Wer dauerhaft betont, dass er seine Arbeit nur dann erledigen könne, wenn der Boss ihn richtig motiviert, der gibt damit indirekt zu, letztlich ein antriebsloser Jammerlappen zu sein. So jemand degradiert sich selbst zum unselbstständigen Esel, der seine Möhre vor der Nase vermisst. Natürlich soll das keine Entschuldigung für wiederkehrende Demütigungen sein. Gegenseitige Achtung, Respekt und Ehrlichkeit sind Voraussetzung für jedes gute Betriebsklima. Aber letztlich liegt es zunächst einmal an einem selbst, die Dinge realistisch zu betrachten: Auch Chefs sind nur Menschen. Sie können nicht alles, und schon gar nicht alles mitbekommen. Wenn also auch sie ungerecht reagieren, sollte man nicht immer alles persönlich nehmen.
Kann man Chefs „umerziehen“?
In gewisser Weise. Chefs lassen sich zum Teil dressieren. Sie springen danach vielleicht nicht durch brennende Reifen, radeln auch nicht hupend über Büroflure und spucken keine Kerzen aus. Aber sie zeigen danach womöglich ein Verhalten, das Ihren Vorstellungen eher entspricht als deren ursprünglichen Instinkten. Die Methode dazu ist klassische Konditionierung. Angenommen, dein Chef gibt dir regelmäßig unklare Anweisungen, weil er vielleicht ein Bauchmensch ist, impulsiv entscheidet und keine Pläne mag, dann passiert Folgendes: Jedes Mal, wenn du das stillschweigend hinnimmst und ausgleichst, bringst du ihm bei: Ich bin ein guter Entscheider, denn am Ende kommt stets etwas Gutes dabei heraus. Und falls dein Boss ständig zotige oder gar frauenfeindliche Kalauer reißt und du dazu grinst, bestätigst du ihn nur in seiner Meinung a) lustig zu sein und b) beliebt.
Aber ausrasten ist schließlich auch keine Lösung.
Nun kann man mit Chefs freilich nicht umspringen wie mit Zirkuslöwen. Das mögen sie überhaupt nicht. Aber Lob mögen sie, egal wie ehrlich oder aufgesetzt das ist. Deshalb lautet die zweite Grundregel für die Dressur der Dschungelkönige: Verstärke positives Verhalten! Statt also in der Kaffeeküche über das schlechte Betragen des Chefs zu maulen oder seine Nervosität und Aggressionen vor Abgabeterminen mit dem bösen Blick zu quittieren, sollten Betroffene lieber die löblichen Ausnahmen mit einem Zückerchen belohnen – etwa mit einem Kompliment oder sublimem Applaus. Und das nächste Mal, wenn er vor einem wichtigen Abgabetermin mal nicht aus der Hose springt, engagierst du dich noch mehr. So lernt er: Ich bin am besten, wenn ich Ruhe bewahre, dann läuft der Laden rund.
Du kommst zu dem Schluss, dass ein kleines Nickerchen nach dem Mittagessen eigentlich perfekt für die Produktivität wäre. Aber wie kann man es seinem Chef und den Mitarbeitern klar machen, dass das nichts mit Faulheit zu tun hat?
Durch bessere Leistung. Oder du gibst demjenigen mein Buch zu lesen. Dort sind zahlreiche Studien zititert, die genau das belegen. Ich glaube aber gar nicht mal, dass die Überzeugungsarbeit so schwer wird. Bei einer Umfrage des IWD Forschungsinstituts kam kürzlich heraus: Jeder dritte Manager ist davon überzeugt, dass er mit zusätzlichen Pausen konzentrierter und effektiver arbeiten würde, 21 Prozent glauben gar, dass sich die Stressbelastung der Mitarbeiter durch Kurzpausen senken ließe. Die Manager halten sich nur meist selbst nicht daran. Wichtig bei Pausen ist allerdings die richtige Portionierung. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen steigt der Erholungseffekt dabei nicht linear. Oder anders ausgedrückt: Man erholt sich vor allem im ersten Drittel einer Pause, danach kaum noch. Deshalb sind lange Pausen nicht effizient. Statt einer 45-minütigen Unterbrechung ist es wesentlich erfrischender über den Tag verteilt drei Mal 15 Minuten abzuschalten.
In Deinem Buch schilderst Du eine Menge interessanter Mitarbeitertypen, von denen in jedem Büro sicherlich mindestens zwei oder drei zu finden sind. Welcher Bürotyp würde am besten zu Dir passen?
Keiner, hoffe ich. Schließlich sind die geschilderten Typologien Extreme – schwierige vor allem. Für den netten, unkomplizierten Kollegen braucht man ja auch keine Ratgeber. Und zu denen würde ich mich aber – ganz unbescheiden – dazu zählen.
Du vergleichst das Büro unter anderem mit einem Dschungel und Menschenzoo. Mit welchen Dingen sollte man sich unbedingt „bewaffnen“, um darin zu überleben?
Mit Selbstbewusstsein, Chuzpe und einem dicken Fell. Das sollte nur bitte nicht so dick sein, dass man zur Not auch ohne Rückgrat aufrecht stehen kann.
Vielen Dank für das nette Gespräch, Jochen Mai.
Hier gibt es meine Rezension zum Buch.
Direkt zum Buch: Die Büro-Alltags-Bibel: Alle Regeln und Gesetze für den Job.